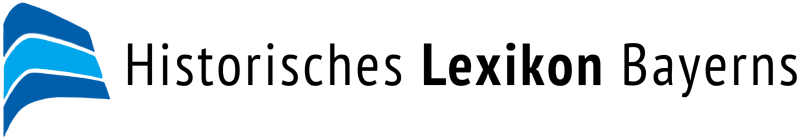Die Beziehungen des Freistaats Bayerns zur Bundesrepublik Deutschland haben eine staatsrechtliche und eine politische Dimension. Während es in staatsrechtlicher Hinsicht den wechselnden bayerischen Staatsregierungen in großer Kontinuität vor allem um die Bewahrung der föderalistischen Grundordnung der Bundesrepublik ging, hingen die politischen Beziehungen vor allem von der parteipolitischen Zusammensetzung von Staats- und Bundesregierung ab. Zentrale Akteure der Beziehungen sind auf bayerischer Seite vor allem der Ministerpräsident, der Bayern nach außen vertritt, sowie der 1962 erstmals berufene Staatsminister für Bundesangelegenheiten. Als wichtigste Institutionen auf Bundesebene haben sich der Bundesrat und die Ministerpräsidentenkonferenz herauskristallisiert. Auf Seiten des Bundes spielt neben der Regierungskoalition mit dem Bundeskanzler an der Spitze in staatsrechtlicher Hinsicht auch das Bundesverfassungsgericht (BVerfG) eine nicht zu unterschätzende Rolle für die Entwicklung der Beziehungen.
Verfassungsrechtliche und politische Grundlagen der Beziehung
Bayerische Verfassung
Das Inkrafttreten der Bayerischen Verfassung am 8. Dezember 1946 konstituierte Bayern als Staat neu. Die Schöpfer der Verfassung betonten im Verfassungstext mehrfach den Staatscharakter Bayerns. Mit dieser Hervorhebung des Eigenstaatlichkeitsanspruchs ging Art. 178 einher, der bestimmte, Bayern werde "einem künftigen deutschen demokratischen Bundesstaat beitreten", der "auf einem freiwilligen Zusammenschluss der deutschen Einzelstaaten" beruhe und "deren staatliches Eigenleben" sichere. Zwar verhinderte die Militärregierung in ihrem Genehmigungsschreiben, dass dieser Artikel als bloße Optionsmöglichkeit interpretiert werden konnte; dennoch blieb er Ausdruck der föderalistischen Grundüberzeugung der bayerischen Politik und wies mit dem Begriff des Bundesstaats auf die künftige deutsche Staatsordnung hin.
Grundgesetz
Bei der Erarbeitung des Grundgesetzes (GG) kam den bayerischen Vertretern dann auch zentrale Bedeutung bei der Durchsetzung der föderalen Elemente zu. Gleichwohl verweigerte der Bayerische Landtag dem Grundgesetz am 20. Mai 1949 wegen der unzureichenden föderalistischen Bestimmungen seine Zustimmung, erkannte in einer Kompromissformel gleichzeitig aber dessen Rechtsverbindlichkeit auch für Bayern an.
Das Grundgesetz übertrug bei der Aufteilung der staatlichen Kompetenzen wie auch der Finanzhoheit dem Bund über die Instrumente der ausschließlichen, konkurrierenden und Rahmengesetzgebung den Großteil der Gesetzgebungsmaterien. Als Ausgleich für diese Dominanz wirkten die Länder über ihre Regierungen im Bundesrat an Gesetzgebung und Verwaltung des Bundes mit und bekamen die überwiegende Zuständigkeit für die Verwaltung. Während auch die Justizorganisation in der Verantwortung der Länder liegt, existiert mit dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG) ein starkes Bundesorgan, das einerseits als Normenkontrolleur das Handeln der Länder auf ihre Vereinbarkeit mit dem Grundgesetz hin überprüfen und andererseits in seiner Funktion als Staatsgerichtshof Streitigkeiten zwischen Bund und Ländern sowie zwischen den Bundesorganen untereinander entscheiden kann.
Eine Koordination der Länder untereinander in ihren Aufgabenbereichen, z. B. mit Staatsverträgen oder gemeinsamen Institutionen wie der Kultusministerkonferenz (KMK), sieht das Grundgesetz zwar nicht explizit vor. Mit den eigenständigen Kompetenzen, die das Grundgesetz den Ländern belässt, ist implizit aber das Recht der Länder auf Zusammenarbeit verbunden.
Politische Dominanz der CSU in Bayern
Neben der Leitidee des Föderalismus prägt das bayerische Verhältnis zum Bund die deutliche Dominanz der bayerischen Landespolitik durch die CSU, die bis auf die kurze Phase der sog. Viererkoalition (1954-1957) in wechselnden Koalitionsregierungen (1946-1954, 1957-1962, 2008-2013, seit 2018) bzw. mit absoluter Mehrheit (1962-2008, 2013-2018) die Staatsregierung führte und den Ministerpräsidenten stellte. Der Doppelcharakter der CSU als eigenständige Partei, die auf Landesebene die Staatsregierung dominiert und auf Bundesebene mit der CDU eine Fraktionsgemeinschaft bildet, ermöglicht der Staatsregierung vor allem in Zeiten unionsgeführter Bundesregierungen großen informellen Einfluss auf die Bundespolitik. Dies wird noch verstärkt, wenn der Ministerpräsident gleichzeitig CSU-Vorsitzender ist und damit im Kreis der Parteivorsitzenden auf Bundesebene Koalitionsverhandlungen über Regierungsprogramme und Kabinettszusammensetzung führt. Diese Konstellation ermöglicht Bayern gegenüber anderen Ländern strukturelle Vorteile bei der Durchsetzung der eigenen Landesinteressen auf Bundesebene.
Die Entwicklung der Beziehungen zwischen Bayern und dem Bund
Staatliche Festigung und Bewältigung der Kriegsfolgen
In den ersten Jahren nach Gründung des Bundes ging es bei den Bund-Länder-Beziehungen zunächst einmal um die Festigung der Rollen und die Überführung der Vorgaben des Grundgesetzes in die Verfassungswirklichkeit. Die Staatsregierung bemühte sich parteiübergreifend, den Föderalismus als konstruktives Element der Staatsordnung zu verankern, das gleichzeitig dem notwendigen Wiederaufbau nicht – wie von seinen Gegnern befürchtet – hemmend im Weg stehen durfte.

Ministerpräsident Hans Ehard (CSU, 1887-1980, Ministerpräsident 1946-1954, 1960-1962) setzte als "Erfinder" und zweiter Präsident des Bundesrates seine Energie einerseits darauf, den Mitwirkungsanspruch des Bundesrates auf möglichst viele Materien bis hin zur Außenpolitik auszudehnen. Gegen den Widerstand der Bundesregierung gelang es dem Bundesrat in den ersten beiden Jahren seiner Existenz, unterstützt vom Bundesverfassungsgericht, die Zahl der Zustimmungsgesetze deutlich auszuweiten. Dies war für Ehard zweischneidig, denn die Regierung Konrad Adenauers (CDU, 1876-1967, Bundeskanzler 1949-1963), deren Politik er als Parteivorsitzender der CSU mittrug und mitverantwortete, hatte im Bundesrat nicht immer sichere Mehrheiten. Gerade Ehard war es aber, der als Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses des Bundesrates mit seiner Verhandlungsführung sowohl der Montanunion als auch den umstrittenen Deutschland- und EVG-Verträgen den Weg im Bundesrat ebnete und damit die Politik der Westbindung nachhaltig unterstützte. Zum anderen war die Staatsregierung unter Hans Ehard beständig bemüht, Einbrüche des Bundes in Länderkompetenzen abzuwehren (z. B. die Versuche, eine Bundesbereitschaftspolizei oder ein Bundesgesundheitsamt zu schaffen). Zu diesem Zweck forcierte Bayern auch die Kooperation der Länder untereinander: So unterstützte es etwa zum einen die Einrichtung der Kultusministerkonferenz und machte zum anderen mit der Einladung zur zweiten Ministerpräsidentenkonferenz 1954 den Anfang zur dauerhaften Etablierung dieser Institution.
Während die Regierung Ehard die Politik Bundeskanzler Adenauers inhaltlich weitgehend mittrug, bedeutete die Bildung der sog. Viererkoalition unter Ministerpräsident Wilhelm Hoegner (SPD, 1887-1980, Ministerpräsident 1945-1946, 1954-1957) den Verlust der Bundesratsmehrheit für die Parteien der Bundesregierung. Die Regierung Hoegner bezog zwar bisweilen Gegenpositionen zur Bundesregierung (Ablehnung der Saarpolitik, Forderung nach einer Freiwilligenarmee), verzichtete aber auf die von manchen befürchtete Blockade gegen die Politik der Westintegration. In der Verteidigung des Föderalismus setzte Hoegner die bisherige Linie fort: Bei der ersten Finanzreform 1955 wandte sich Bayern etwa aus grundsätzlichen Erwägungen gegen die Einführung des kleinen Steuerverbundes und des unbefristeten Länderfinanzausgleichs, obgleich es als Nehmerland von den neuen Regelungen profitierte.
Labiler Föderalismus am Ende der Ära Adenauer
Mit dem vorzeitigen Ende der Viererkoalition und der Wahl des CSU-Vorsitzenden Hanns Seidel (CSU, 1901-1961, eigtl. Franz Wendelin Seidel, Ministerpräsident 1957-1960) zum Ministerpräsidenten war die parteipolitische Übereinstimmung von Landes- und Bundesregierung wiederhergestellt, sodass Bayern seitdem im Wesentlichen wieder die Politik der Bundesregierung im Bundesrat unterstützte.
Ende der 1950er Jahre engte sich der eigene Spielraum der Landespolitik immer weiter ein. Der Bund beanspruchte mit Bundesgesetzen wie dem Lastenausgleich große Kapazitäten der Länderverwaltungen und besetzte immer mehr Felder der konkurrierenden Gesetzgebung: Durch die "Grünen Pläne" (seit 1956) und die Gemeinsame Agrarpolitik der EWG (seit 1962) wurden die Einflussmöglichkeiten der Staatsregierung auf die Struktur des noch vielfach stark agrarisch geprägten Freistaats erheblich beschnitten. Rahmengesetze des Bundes zwangen die Landespolitik zu Gesetzesneufassungen (Beamtengesetz 1960, Wassergesetz 1962).
Das Bundesverfassungsgericht verhinderte zwar manche Übergriffe des Bundes auf die Kulturhoheit der Länder (Konkordatsurteil 1957, 1. Rundfunk-Urteil 1961), unterstützte aber unter Berufung auf das Postulat einheitlicher Lebensverhältnisse (Art. 72 GG) die weitreichende Ausschöpfung der konkurrierenden und Rahmengesetzgebung durch den Bund. Länder, die finanzschwächer waren oder sich dem Föderalismus weniger verpflichtet fühlten, konnten oder wollten einer fortschreitenden sachlichen Unitarisierung wenig entgegensetzen. Bayern verteidigte dagegen vor allem in der Kulturpolitik einerseits die Länderhoheit (Ablehnung des "Düsseldorfer Abkommens" der Länder zur stärkeren Vereinheitlichung des Schulwesens 1955); andererseits erschien aber auch den bayerischen Staatsregierungen eine präventive Kooperation der Länder untereinander (KMK-Beschluss zur neuen Oberstufe 1960, ZDF-Staatsvertrag 1962) und mit dem Bund (Wissenschaftsrat 1957, Revision des Königsteiner Abkommens 1964, Dt. Bildungsrat 1965) unumgänglich, um weitere Zugriffe des Bundes zu verhindern, die etwa durch die Errichtung des Bundesministeriums für Bildung und Wissenschaft 1962 drohten.
Gleichzeitig mit dem Ausgreifen der Bundespolitik auf Länderkompetenzen drang aber auch vor allem Bayern seinerseits gezielt in Bundesdomänen vor: Die Ministerpräsidenten setzten mit zunehmenden Auslandsreisen und direkten Kontakten zu Nachbarstaaten wie Österreich (Salinenkonvention 1957) eigene Akzente in der Außenpolitik, trieben unter Umgehung der Bundesregierung direkte Beziehungen zu den entstehenden europäischen Institutionen voran und nutzten eigene außenhandelspolitische Initiativen für die wirtschaftspolitischen Interessen Bayerns.

Politische und föderale Konflikte in den 1960er Jahren
Obgleich die Unionsparteien mit Ludwig Erhard (CDU, 1897-1977, Bundeskanzler 1963-1966) als Spitzenkandidat die Bundestagswahl 1965 deutlich gewannen, wuchs im folgenden Jahr innerhalb von CSU und bayerischer Staatsregierung die Unzufriedenheit mit der Politik des Bundeskanzlers. Gründe dafür lagen vor allem in der außenpolitischen Orientierung des "Atlantikers" Erhard sowie seiner politischen Führungsschwäche in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik. Nachdem Erhards Koalition mit der FDP im Oktober 1966 zerbrochen war, forderte auch Ministerpräsident Alfons Goppel (CSU, 1905-1991, Ministerpräsident 1962-1978) aus Furcht vor einem schlechten Abschneiden bei der Landtagswahl öffentlich den Rücktritt Erhards.
Ihm folgte an der Spitze einer großen Koalition aus Union und SPD Kurt Georg Kiesinger (CDU, 1904-1988, Bundeskanzler 1966-69) als Bundeskanzler. Obwohl damit erstmals ein vormaliger Ministerpräsident Regierungschef wurde, geriet der Föderalismus in den 1960er Jahren zunehmend in die Defensive. Goppel hatte institutionell darauf schon 1962 mit der Ernennung eines Staatsministers für Bundesangelegenheiten reagiert, aber auch innerhalb der Unionsparteien galt der Föderalismus manchen als zu schwerfälliger Entscheidungsmechanismus angesichts der Herausforderungen der Moderne. Die klare Kompetenzabgrenzung zwischen den staatlichen Ebenen vertrug sich zudem nicht mit der aufkommenden Planungseuphorie, die zentrale Steuerungsinstrumente befürwortete. Die von Bundeskanzler Kurt Georg Kiesinger und den Ministerpräsidenten eingesetzte Kommission (sog. Troeger-Kommission) unter der Leitung von Heinrich Troeger (SPD, 1901-1975, Vizepräsident der Deutschen Bundesbank 1958-1969) sah denn in ihrem "Gutachten über die Finanzreform in der BRD" 1966 auch eine Generalermächtigung für den Bund vor, sog. Gemeinschaftsaufgaben zu definieren, bei deren Erfüllung künftig Bund und Länder zusammenwirken sollten. Eine Grundgesetzänderung sollte die ohnehin bereits praktizierte Mitfinanzierung von Länderaufgaben durch den Bund verfassungsrechtlich absichern.
Die Staatsregierung lehnte zwar die Finanzreform des Jahres 1969 mit der Einführung von drei Gemeinschaftsaufgaben (Regionalpolitik, Agrarstrukturpolitik, Hochschulbau), eines großen Steuerverbunds, eines intensivierten Länderfinanzausgleichs und von Planungselementen ab. Ihr Verhandlungspartner auf Bundesebene war allerdings der CSU-Vorsitzende Franz Josef Strauß (CSU, 1915-1988, Bundesfinanzminister 1966-1969) als Bundesfinanzminister, der die Verflechtung der Aufgaben in einer modernen Gesellschaft ebenso anführte wie die Finanzschwäche vieler Länder. Zwar blieb Bayern bei seiner inhaltlichen Ablehnung, stimmte aber nach einigen Zugeständnissen aus übergeordneten Gründen der Verfassungsänderung im Bundesrat zu. Damit erlitt vor allem der Landtag einen Bedeutungsverlust, während die Staatsregierung über den Bundesrat und die gemeinsamen Bund-Länder-Gremien zumindest an den Entscheidungsprozessen weiter beteiligt blieb.
Die politische Polarisierung der 1970er Jahre
Die Bildung der sozialliberalen Koalition aus SPD und FDP auf Bundesebene 1969 war eine deutliche Zäsur in den Beziehungen zwischen Bayern und dem Bund. Die CSU verlor ihre bisherigen Einflussmöglichkeiten als Teil der Bundesregierung und war nun umso stärker auf den unionsdominierten Bundesrat und das Bundesverfassungsgericht als bundespolitische Vetospieler angewiesen, um in einer Phase starker parteipolitischer Polarisierung die Bundespolitik weiter beeinflussen zu können.
Damit änderte sich auch die Rolle der Staatsregierung, obgleich Ministerpräsident Goppel den Großteil der konfrontativen Oppositionsarbeit Franz Josef Strauß überließ: Hatte Bayern bis 1968 nur 15 Gesetzesinitiativen in den Bundesrat eingebracht, waren es von 1969 bis 1972 schon 22, die sich vor allem in der Rechts- und Sozialpolitik gegen die Regierung von Bundeskanzler Willy Brandt (SPD, 1913-1992, Bundeskanzler 1969-1974) richteten. Diese Initiativen scheiterten in der Regel an der sozialliberalen Mehrheit im Bundestag und dienten eher einer öffentlichkeitswirksamen Positionierung als bürgerliche Alternative. Dagegen beeinflussten bayerische Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht die Bundespolitik wesentlich stärker, z. B. die erfolgreiche Klage gegen die Fristenlösung des § 218 StGB (Abtreibung). Die Klage gegen den Grundlagenvertrag mit der DDR lehnte das Gericht zwar formal ab, es übernahm in seiner Interpretation des Vertrags allerdings die bayerischen Positionen weitgehend und machte damit verbindliche Vorgaben für die Deutschlandpolitik, die ganz im Sinne der Staatsregierung und der CSU waren.
Die Verteidigung des Föderalismus trat hinter der parteipolitischen Polarisierung der Zeit etwas zurück. Zum einen war das Konzept einer stärker zentral gesteuerten gesamtstaatlichen Aufgabenplanung bereits früh am Autonomiestreben der Bundesministerien gescheitert. Zum anderen kam es seit Mitte der 1970er Jahre zu keinen relevanten Kompetenzverschiebungen mehr. Die sozialliberale Koalition versuchte im Gegenteil wegen der Belastung des Bundeshaushalts den Bundesanteil an den Mischfinanzierungen (nicht jedoch an den Entscheidungsstrukturen) zurückzufahren, wogegen sich nun die Länder wehrten.
Beziehungen im Zeichen von europäischer Integration und deutscher Einheit
Ministerpräsident Franz Josef Strauß scheiterte 1980 als Kanzlerkandidat der Unionsparteien nicht zuletzt auch an der nur zögerlichen Unterstützung einiger CDU-Landesverbände. Mit der Bildung der christlich-liberalen Koalition aus CDU/CSU und FDP 1982 verbesserte sich das Verhältnis der Staatsregierung zum Bund schlagartig, auch wenn die persönliche Rivalität der Vorsitzenden der beiden Unionsparteien, Bundeskanzler Helmut Kohl (CDU, 1930-2017, Bundeskanzler 1982-1998) und Ministerpräsident Franz Josef Strauß, beständiges Thema politischer Beobachter blieb.

Für die Beziehungen entscheidender war, dass die europäische Integration mit der Einheitlichen Europäischen Akte 1986 und dem Vertrag von Maastricht 1992 in eine neue Phase eintrat, in der wichtige nationale Souveränitätsrechte auf die europäische Ebene übertragen und damit dem eigentlich grundgesetzlich garantierten Mitwirkungsrecht der Länder entzogen wurden. Gegen diese Entwicklung hatte sich Bayern schon seit den Anfängen der Integration in den 1950er Jahren gewehrt. Angesichts der Zustimmungsbedürftigkeit der Integrationsverträge im Bundesrat gelang es den Ländern nun unter maßgeblichem Einfluss Bayerns, ihre Beteiligungsrechte gipfelnd im neuen Europa-Artikel 23 des Grundgesetzes verfassungsrechtlich festzuschreiben und mit der Aufnahme des Subsidiaritätsprinzips und der Einrichtung des Ausschusses der Regionen die Länder erstmals auch in den europäischen Verträgen zu verankern.
Parallel dazu musste sich das Bund-Länder-Verhältnis auch angesichts der deutschen Wiedervereinigung neu sortieren. Mit der "Münchner Erklärung", die am 21. Dezember 1990 auf der ersten gesamtdeutschen Ministerpräsidentenkonferenz seit 1947 gefasst wurde, betonte Bayern seinen föderalistischen Führungsanspruch. Während die Länder bei ihrer Forderung nach einer stärkeren Beteiligung an der Europapolitik unbestreitbare Erfolge erzielten, konnten sie sich im Streben nach einer umfassenden Neuordnung der Gesetzgebungskompetenzen und Finanzbeziehungen in der "Gemeinsamen Verfassungskommission des Bundestages und des Bundesrates" 1993/1994 gegen den Bund kaum durchsetzen. Auch Bayern selbst verlor im Bundesrat relativ an politischem Gewicht, obgleich die Stimmenzahl der großen Länder im neuen Bundesrat von fünf auf sechs erhöht wurde. Zudem flossen über den Länderfinanzausgleich und den "Aufbau Ost" enorme Summen aus dem wirtschaftsstarken Süddeutschland in die neuen Länder. Vor allem Ministerpräsident Edmund Stoiber (CSU, geb. 1941, Ministerpräsident 1993-2007) forderte deshalb zunehmend deutlich mehr Wettbewerb unter den Ländern. Eine Klage gemeinsam mit Baden-Württemberg und Hessen gegen den bestehenden Länderfinanzausgleich, der wirtschaftsstarke Länder zu stark nach unten nivelliere, war 1999 vor dem Bundesverfassungsgericht erfolgreich.
Ungeachtet dieses bayernfreundlichen Ergebnisses wurde das Bundesverfassungsgericht Mitte der 1990er Jahre massiv aus Bayern kritisiert, weil die Staatsregierung einige Urteile ("Freigabe von Haschisch", "Kruzifix-Beschluss", "Soldaten sind Mörder") als Frontalangriff auf die politische und kulturelle Prägung Bayerns auffasste.
Waren bereits die Umstände der Euro-Einführung zum 1. Januar 1999 zwischen der Staatsregierung und der Bundesregierung umstritten, verschlechterten sich die politischen Beziehungen zwischen Bayern und dem Bund massiv, als 1998 SPD und Grüne die Bundestagswahl gewannen und zugleich über eine knappe Mehrheit im Bundesrat verfügten. Angesichts der Schwäche der CDU nach der Parteispendenaffäre avancierte Ministerpräsident Stoiber als CSU-Vorsitzender zur treibenden Kraft der Union, der die politische Opposition aus dem Bundesrat heraus organisierte, in dem die unionsgeführten Länder seit 1999 wieder die Mehrheit hatten. Bei der Bundestagswahl 2002 scheiterte Stoiber gleichwohl als CDU/CSU-Kanzlerkandidat.
Jüngere Entwicklungen
Föderalismusreformen I, II und III
Ministerpräsident Stoiber forderte unter dem Schlagwort des Wettbewerbsföderalismus mehr Handlungsspielräume für die leistungsstarken Länder. Als Verhandlungsführer der Länder in der gemeinsamen Föderalismuskommission von Bundestag und Bundesrat war Stoiber entscheidend daran beteiligt, dass mit der Föderalismusreform I im Jahr 2006 erstmals in der Geschichte des Grundgesetzes wieder substantielle Kompetenzen (Hochschulbau, Bildungsplanung, Beamtenrecht, Abweichungskompetenz im Umweltrecht) auf die Länder zurückverlagert wurden. Die Föderalismuskommission II entsprach zwar 2009 mit der Aufnahme einer "Schuldenbremse" ins Grundgesetz besonders der von Stoiber forcierten Politik der Haushaltsdisziplin. Sie blieb aber hinter dem Anspruch einer umfassenden Neuregelung der Bund-Länder-Finanzbeziehungen zurück. 2013 klagten Bayern und Hessen erneut gegen den Länderfinanzausgleich und brachten damit Bewegung in die Verhandlungen, die 2017 mit einem Kompromiss abgeschlossen wurden. Danach werden die Geberländer zulasten des Bundes ab 2020 weniger in den Länderfinanzausgleich einzahlen, der Bund aber gleichzeitig Eingriffsmöglichkeiten in die (Finanz-)Verwaltungshoheit der Länder und die Zuständigkeit für die Verwaltung der Bundesautobahnen bekommen.
Bayern und die Regierung Merkel

Seit dem Regierungswechsel 2005 ist die CSU wieder an der Bundesregierung beteiligt. Seit 2008 war Ministerpräsident Horst Seehofer (CSU, geb. 1949, Ministerpräsident 2008-2018, Bundesinnenminister 2018-2021) als CSU-Vorsitzender zugleich im wichtigen Koalitionsausschuss vertreten. Die Staatsregierung trug in der Folge die Politik von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU, geb. Angela Kasner, geb. 1954, Bundeskanzlerin 2005-2021) während der Finanz- und Staatsschuldenkrise und auch bei umstrittenen Entscheidungen (Energiewende, Aussetzung Wehrpflicht, Euro-Rettung) mit. Während der Jahre 2015/2016 kam es jedoch zu einem schweren politischen Konflikt über den angemessenen Umgang mit der sog. Migrationskrise, der das Verhältnis sowohl zwischen der Staatsregierung und der Bundesregierung als auch zwischen der CSU und ihren beiden Koalitionspartnern CDU und SPD innerhalb der Regierungskoalition nachhaltig belastete.
Literatur
- Arthur Benz/Gerhard Lehmbruch (Hg.), Föderalismus. Analysen in entwicklungsgeschichtlicher und vergleichender Perspektive, Wiesbaden 2002.
- Matthias Bode, Die auswärtige Kulturverwaltung der frühen Bundesrepublik. Eine Untersuchung ihrer Etablierung zwischen Norminterpretation und Normgenese, Tübingen 2014.
- Karl-Ulrich Gelberg, Hans Ehard. Die föderalistische Politik des bayerischen Ministerpräsidenten 1946-1954, Düsseldorf 1992.
- Peter Jakob Kock, Bayern und Deutschland. Föderalismus als Anspruch und Wirklichkeit, in: Wolfgang Benz (Hg.), Neuanfang in Bayern 1945-1949. Politik und Gesellschaft in der Nachkriegszeit, München 1988, 183-204.
- Peter Jakob Kock, Bayerns Weg in die Bundesrepublik, München 2. Auflage 1988.
- Sabine Kropp, Kooperativer Föderalismus und Politikverflechtung, Wiesbaden 2010.
- Heinz Laufer/Ursula Münch, Das föderale System der Bundesrepublik Deutschland, München 2010.
- Ursula Münch, Freistaat im Bundesstaat. Bayerns Politik in 50 Jahren Bundesrepublik Deutschland, München 1999.
- Wolfgang Renzsch, Finanzverfassung und Finanzausgleich. Die Auseinandersetzung um ihre politische Gestaltung in der Bundesrepublik Deutschland zwischen Währungsreform und deutscher Vereinigung (1948 bis 1990), Bonn 1991.
- Petra Weber, Föderalismus und Lobbyismus. Die CSU-Landesgruppe zwischen Bundes- und Landespolitik 1949 bis 1969, in: Thomas Schlemmer/Hans Woller (Hg.), Bayern im Bund. 3. Band: Politik und Kultur im föderativen Staat 1949-1973, München 2004, 23-116.
- Alexander Wegmaier, Die Idee Europa und die Anfänge der bayerischen Europapolitik 1945 bis 1979 (Schriftenreihe zur bayerischen Landesgeschichte 171), München 2018.
Weiterführende Recherche
Externe Links
Verwandte Artikel
- Bundesrat
- Föderalismus
- Gesetzgebung (nach 1945)
- Länderfinanzausgleich
- Münchener Ministerpräsidentenkonferenzen
- Ständige Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik Deutschland (KMK)
- Verfassungskonvent von Herrenchiemsee, 10.-23. August 1948
- Vertretung des Freistaates Bayern bei der Europäischen Union
Bayern und der Bund, Bayern im Bund
Empfohlene Zitierweise
Alexander Wegmaier, Beziehungen zum Bund, publiziert am 29.10.2018; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Beziehungen_zum_Bund> (08.02.2026)