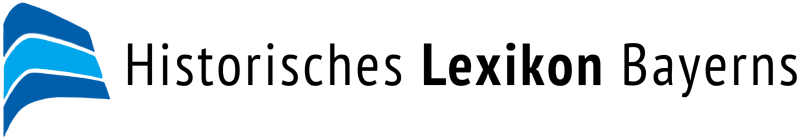Sprachgeschichtliche Periode im Übergang vom Mittelhochdeutschen zum Neuhochdeutschen, die im bayerisch-österreichischen Sprachraum vom 14. bis ins 18. Jahrhundert andauerte. Die allmähliche Ablösung des Lateinischen durch die deutsche Volkssprache in den Kanzleien, die "Literaturexplosion" des 15. Jahrhunderts sowie die Zunahme deutscher Literatur angesichts von Reformation und Gegenreformation (16./17. Jahrhundert) beförderten die Ausprägung einer baierischen Standardsprache, die zu einer der führenden deutschen Schreibsprachen wurde. Im 17. Jahrhundert festigte sie sich als "oberdeutsche Literatursprache". Sie zeichnet sich durch Besonderheiten in Orthographie, Morphologie und Stilistik aus. Im Vergleich zu den protestantischen Ländern erschienen erst spät Grammatiken (18. Jahrhundert). Den Übergang zum Neuhochdeutschen vollzog in Bayern zuerst die 1759 gegründete Bayerische Akademie der Wissenschaften. Seit dem 13./14. Jahrhundert hatten sich die gesprochenen regionalen Dialekte gebildet. Sie wurden im 18. Jahrhundert Gegenstand des sprachgeschichtlichen Interesses.
Periodisierung und Charakterisierung
Als Frühneuhochdeutsch bezeichnet man die sprachgeschichtliche Periode von der Mitte des 14. bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts. Sprachliches Hauptmerkmal ist der hohe Grad an Variabilität in regionaler, sozialer und stilistischer Hinsicht und das Fehlen einer Leitvarietät. So existierten im 15. Jahrhundert noch mehrere gleichrangige Schreibsprachen. Um 1600 bestanden allerdings nur noch zwei regionale Spielarten, das stark ostmitteldeutsch geprägte Hochdeutsche und das Oberdeutsche.
Die frühneuhochdeutsche Periode des Süddeutschen und insbesondere des Bayerisch-Österreichischen dauerte hingegen etwa 100 Jahre länger (bis in die Mitte des 18. Jahrhunderts). Sie umfasste den Zeitraum etwa von Kaiser Ludwig dem Bayern (reg. 1314-1347) bis zu Kurfürst Max III. Joseph (reg. 1745-1777), vom ca. 1350 verfassten "Buch der Natur" Konrads von Megenberg (1309-1374) bis zur Gründung der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (1759).
Die Zäsur zum vorausgehenden Mittelhochdeutschen ist nur schwach ausgeprägt. Im Verlauf des 13. Jahrhunderts gewann die südostdeutsche Schreibsprache gegenüber den benachbarten fränkischen und schwäbisch-alemannischen Schreibsprachen deutlich schärfere Konturen. Sie entwickelte sich vom 14. bis ins 16. Jahrhundert kontinuierlich weiter, nicht ohne Veränderungen und nicht ohne Beeinflussungen von außen, aber ohne einschneidende Brüche. Einen tiefen Einschnitt bedeutete der Übergang von der oberdeutschen Literatursprache des 17. und 18. Jahrhunderts zum modernen Neuhochdeutschen in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, der von den Betroffenen auch als solcher wahrgenommen wurde.
Die vier Jahrhunderte vom 14. bis zum 18. Jahrhundert lassen sich gut in zwei etwa gleich lange Hälften teilen, in das spätmittelalterliche Deutsch und in das Frühneuhochdeutsche im engeren Sinn (oberdeutsche Literatursprache). Die Grenze markieren die Bauernkriege, die Reformation und die beginnende Gegenreformation mit dem Wirken der Jesuiten (seit 1556). Zusammen mit Österreich bildet Altbayern den Sprachraum des "Bairischen".
Geschriebene und gesprochene Sprache, Hochsprache und Dialekte
Nur die Geschichte der geschriebenen Sprache ist unmittelbar zugänglich. Gesprochene Sprache kann nur in engen Grenzen erschlossen werden. Da um 1500 kaum 5 % und noch im 18. Jahrhundert höchstens 10 % der Bevölkerung schreiben und lesen konnten, lässt sich über die Sprache der Masse nichts Sicheres aussagen. Sicher gab es sozial bedingte Sprachunterschiede. Der Geschichtsschreiber Johannes Aventinus (1477-1534) berichtete im 16. Jahrhundert über sprachliche Verschiedenheiten zwischen Stadt und Land. Seit dem Hochmittelalter bildeten sich regional abgrenzbare Sprachunterschiede deutlicher aus, so dass sich seit dem 13./14. Jahrhundert die bairischen Dialektlandschaften entwickelten. In geschriebener Sprache wurden solche Merkmale aber zugunsten der schreibsprachlichen Konventionen tendenziell unterdrückt. Erst im 18. Jahrhundert wurden Dialekte um ihrer selbst willen aufgezeichnet.
Die kulturellen Grundlagen der Sprachentwicklung im Spätmittelalter (14. bis 16. Jahrhundert)
Während bis ins hohe Mittelalter vor allem Geistliche das Lesen und Schreiben praktizierten, drängten seit dem späten 13., verstärkt seit dem 14. Jahrhundert zunehmend laikale Schichten zur Schrift. Das Deutsche eroberte sich somit lebenspraktische Textsorten, die bis dahin dem Lateinischen vorbehalten waren (das breite Spektrum der Fachliteratur, Rechtsbücher und Urkunden, Chronistik, früher schon die Predigt). Die Melker Reform bewirkte in der ersten Hälfte des 15. Jahrhunderts einen kräftigen Schub an geistlich-erbaulicher Literatur, die auch in Bayern breit rezipiert wurde. Zusammen mit materiellen Erleichterungen wie der allmählichen Ablösung des Beschreibstoffes Pergament durch das billigere Papier (erste Papiermühle in Deutschland in Nürnberg 1389) und der Verbreitung der Lesebrille wurde die "Literaturexplosion" (Hugo Kuhn, 1909-1978) des 15. Jahrhunderts ausgelöst.
Die Erfindung des Buchdrucks war dann eine naheliegende Konsequenz dieser Entwicklung. Von ihm profitierte allerdings die Produktion lateinischer Bücher zunächst sehr viel mehr als die deutscher Bücher. Erst die Reformation führte zu einer starken Zunahme deutscher Titel, allerdings vorrangig solcher der neuen Kirche. In Bayern setzte sich der Buchdruck erst mit geringer Verzögerung durch. Hauptorte des Buchdrucks wie Augsburg, Ulm oder Nürnberg lagen zwar in unmittelbarer Nachbarschaft, aber doch außerhalb Bayerns.
Bayern hatte am Vordringen der Volkssprache in neue Bereiche starken Anteil. Die ältesten deutschsprachigen Urkunden stammen zwar aus Südwestdeutschland, aber im Verlauf der letzten zwei Jahrzehnte des 13. Jahrhunderts stieg der Anteil deutscher Urkunden auch in Bayern rapide an. Unter Kaiser Ludwig dem Bayern erstellte sogar die kaiserliche Kanzlei einen Gutteil ihrer Urkunden in deutscher Sprache. Der Regensburger Domherr Konrad von Megenberg, der produktive Münchner Hofarzt Johannes Hartlieb (um 1400-1468) und Johannes Aventinus ("Baierische Chronik", 1522-33) schufen Werke von überregionaler Bedeutung. Den konservativen Geschmack des Münchner Hofes Albrechts IV. (reg. 1465-1508) bediente Ulrich Fuetrers (um 1420-1496/1500) "Buch der Abenteuer" (1473-1478). Einblick in die Gebrauchssprache erlauben etwa das Urbarbuch und Inventar des Ritters Erhard Rainer von Schambach (gest. 1390) aus der Nähe von Straubing (1376), die Denkschrift des Münchner Bürgermeisters Jörg Kazmair (gest. 1417) über die Unruhen in München 1397-1403 oder das Hauptbuch des Regensburger Fernhandelshauses Runtinger (1383-1407).
Die gehobenen Schulen standen weiterhin unter geistlicher Leitung und lehrten vor allem Latein (Lateinschulen). Der Muttersprache kam nur dienende Funktion zu. Über "deutsche" Schulen, welche die Bedürfnisse der Bürger in Handel und Gewerbe befriedigen sollten, erfahren wir seit dem 15. Jahrhundert vor allem aus Nord- und Westdeutschland, nur vereinzelt aus Bayern. Immerhin stammt aber eine frühe "Leselehre" (Modus legendi, 1477) von dem wandernden niederbayerischen Schulmeister Christoph Hueber. Aventin setzte an den Anfang seiner Bayerischen Chronik ein Kapitel über "die alten teutschen näm" mit Informationen zur bayerischen Lautlehre.
Schreibsprache im Spätmittelalter
Seit dem 13. Jahrhundert gingen im bayerisch-österreichischen Sprachraum Veränderungen vor sich, die zu einem erheblichen Teil bis heute weiterleben (z. T. nur in den Dialekten). Sie fanden, oft gebrochen, in den historischen Schreibsprachen ihren Niederschlag. Da die älteren Sprachen keine normative Grammatik kannten, sind die folgenden Angaben nur Richtwerte in einem variablen System.
Die bairische Schreibsprache war vor allem durch Besonderheiten der Orthographie und der Morphologie charakterisiert. Charakteristisch sind <ai> für mhd. ei (haiß, brait, stain) und <p; kh/ch> für mhd. b- und k (perg, prunn, pichl; chorn, khind, akkher, -purch, Cham, Chiemsee). Vollständig durchgeführt wurde die Diphthongierung der Langvokale mhd. î, û, iu zu ei, au, äu (weit, haus, läute), überwiegend auch in Nebensilben (Ludweig, Hainreich, guldein, nataur). <ai> diente der graphischen Unterscheidung des alten Diphthongen (dialektal [oi,oa]) von dem aus mhd. î entstandenen ei. Erhalten blieben die mhd. Diphthonge ie, uo/ue, üe (dialektal [ia, ua]). Vor allem mhd. ie (lieb, pieten, brief, liecht) und i (siben, geschriben, dise) wurden konsequent geschieden (erst im 18. Jahrhundert setzte sich <ie> als Dehnungszeichen aus dem mitteldeutschen Schreibgebrauch auch im Süden stärker durch). Auffällig ist die häufige Schreibung <b> für w (gebinnen, ebig, basser), seltener umgekehrt <w> für b (Wischof, Warbara, Waltasar/Waldhauser, gewurt). Aus der Morphologie und Wortbildung sind typisch bairisch die Endungen -und im Partizip Präsens (prinnund 'brennend'), -ist im Superlativ der Adjektive (eltist, nidrigist) und die Wortbildungsendung -nus(s) für -nis (zeugnus).
Zwischen der bairischen Schreibsprache und dem gesprochenen Bairisch bestanden systematische Entsprechungen. Die bairische Schreibsprache bildete jedoch nicht die Dialekte ab, sondern fungierte als regionale Standardsprache. Sie war eine der führenden deutschen Schreibsprachen und beeinflusste auch das Ostmitteldeutsche. Für Martin Luther (vermutl. 1483-1546) war sie eine der deutschen Normsprachen. Interferenzen aus den Dialekten unterliefen vor allem weniger gut ausgebildeten Schreibern.
Die kulturellen Grundlagen der Sprachentwicklung in der frühen Neuzeit (16. bis 18. Jahrhundert)
Die tiefgreifenden Veränderungen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts wirkten sich auch in Bayern voll aus. Die bayerischen Herzöge und die Universität Ingolstadt (Johannes Eck, 1486-1543) widersetzten sich entschieden und mit Erfolg der Reformation, die im Adel und im Bürgertum durchaus Zuspruch gefunden hatte. In Ingolstadt und München erschienen lateinische und volkssprachige Druckschriften im Dienst der alten Kirche. Die um die Mitte des 16. Jahrhunderts ins Land geholten Jesuiten betrieben zusammen mit dem Herrscherhaus die Gegenreformation bzw. katholische Reform, die das religiöse, geistige und kulturelle Leben entscheidend prägte. Namhafte österreichische Emigranten wie Johann Beer (1655-1700), Wolfgang Helmhard von Hohberg (1612-1688) sowie die Familie von Johann Ludwig Prasch (1637-1690) ließen sich in der 1542 protestantisch gewordenen Reichsstadt Regensburg nieder, wo sie Bücher publizieren konnten, für die in den katholischen Ländern kein Platz war.

Die Gegenreformation nahm die Literatur voll in ihren Dienst. Das 17. Jahrhundert war die Zeit bedeutender Autoren aus dem Jesuitenorden. Jakob Bidermann (1578-1639), Jakob Balde (1604-1668) und Jeremias Drexel (1581-1638) schrieben zwar lateinisch, hatten aber in Joachim Meichel (um 1590-1637) einen wirkungssicheren Übersetzer zur Seite. Der Niederländer Aegidius Albertinus (1560-1620) übersetzte in München den ersten deutschen Schelmenroman aus dem Spanischen ("Der Landstörzer Gusman von Alfarache", 1615). Große Bedeutung kam den Predigten und den geistlichen und weltlichen Spielen zu, die auch die Masse der Leseunkundigen erreichten.
Grammatische Beschreibungen des Deutschen erschienen in den protestantischen Ländern, in Bayern erst seit dem 18. Jahrhundert. Nur Johann Ludwig Prasch veröffentlichte in Regensburg eine "Sprachkunst" (1687) und das älteste bayerische Dialekt-Idiotikon (Glossarium Bavaricum, 1689).
Die oberdeutsche Literatursprache
Seit der Mitte des 16. Jahrhunderts traten einige Charakteristika der älteren Schreibsprache deutlich zurück, die schon zu Anfang des Jahrhunderts seltener geworden waren. Die p- und kh/ch-Schreibungen wurden obsolet und tendenziell durch b- und k- ersetzt, die Verteilung von ä und e wurde z. T. neu geregelt, die Diphthongierung von î in Endsilben (güldein, Hainreich, Ludweig usw.) zurückgenommen (gülden, Hainrich usw.), die w/b-Vertauschung (gebinnen, gewurt) aufgegeben, der Dreiformenplural im Indikativ Präsens der Verben (wir machen, ir macht, sie machent) wurde durch den Zweiformenplural ersetzt (wir/sie machen, ir macht) u. a. Der Umlaut von o, u, der lange Zeit unbezeichnet blieb, wurde jetzt durch ö, ü angezeigt (göttlich, über). Dazu kamen einige Übernahmen aus der mitteldeutschen Schreibsprache, vor allem o/ö für u/ü vor Nasal (sondern, fromm, König, z. T. über die spätere Norm hinaus: Konst, konftig; die gesprochene Sprache wie die Dialekte blieben bei u). Auch das unetymologische Dehnungs-h stammt aus dem Mitteldeutschen (vor allem vor r, m, n: Jahr, jhr, ihm, jhn, Lohn, dazu Ehe, Rueh, Müh u. v. a., ferner nach t: thuen, Thail, Rath usw.).
Zwischen der Orthographie handschriftlicher und gedruckter Zeugnisse bestanden recht deutliche Unterschiede. Die Sprache der Drucker war lange Zeit "moderner" und weniger variantenreich. Im 17. Jahrhundert konsolidierte sich eine Druckersprache mit oberdeutsch-bairischem Gepräge, die man als oberdeutsche Literatursprache bezeichnen kann. Sie wurde von den Druckern in Bayern und Österreich (dominierend München, Ingolstadt, Wien, etwas später Salzburg, Innsbruck, Graz) sowie in Schwaben (Augsburg, Dillingen) verwendet. Sebastian Helber (um 1530-1598) nannte in seinem "Syllabierbüchlein" (1593) diese Druckersprache die "Donauische". Der in der Forschung heute dafür öfter verwendete Begriff "Gemeines Deutsch" bezeichnete in zeitgenössischen Quellen einen Stilbegriff ('allgemein verständliches Deutsch' im Gegensatz zu der am Latein orientierten Gelehrtensprache), nicht eine Regionalsprache.
Die oberdeutsche Literatursprache war die Sprache der katholischen Literatur und Kultur Süddeutschlands, in der Bayern eine führende Rolle spielte. Sie blieb dort bis weit ins 18. Jahrhundert hinein prägend und unterschied sich vom ostmitteldeutsch geprägten "Hochdeutschen" der evangelischen Länder deutlich. Dass man von einer katholischen Leitvarietät sprechen kann, beweisen Ausstrahlungen bis Freiburg, Mainz und Köln. Evangelische Buchdrucker in Regensburg schlossen sich ihr nicht an. Es liegt nahe, dass die Ausbildung dieses Sprachtypus ein Ergebnis der systematischen Bildungsarbeit der Jesuiten und ihrer Zusammenarbeit mit den bayerischen Herzögen war.
Die Sprachformen der oberdeutschen Literatursprache
Von den orthographischen Leitformen der oberdeutschen Literatursprache seien genannt: häufige <ai, ue, üe> für mhd. ei, uo, üe (seit dem späten 17. Jahrhundert seltener); Meidung des mitteldeutschen Dehnungs-ie, d. h. <i> für langes i (dise, geschriben, ligen; <ie> hingegen für den Diphthong, z. B. in Liecht, Brief); Doppelschreibung für langes e, a, o (Weeg, See, Maaß usw.); häufige Entrundung von ü, üe, ö, eu (Hitten, Biecher, gresser, Freindt) und hyperkorrekte Schreibungen wie Würckung, Hülff, leucht (<ö> dient vor allem als Zeichen für geschlossenes e in bösser, gwösen usw.); Umlautlosigkeit in bestimmten Positionen (Brucken, nutzlich, hupfen, Burger, traumen, Erkantnuß).
Morphologische Charakteristika sind die Unterdrückung unbetonter e (Apo-, Synkope) vor allem bei Substantiven, weniger bei Verben (Gnad, Ehr, Gschicht; ich hab, er redt usw.), die Generalisierung von -en auch im Nominativ Singular vieler Feminina (Kirchen, Wisen, Glocken, daneben endungslos Kirch, Wis), häufige Pluralbildung durch Umlaut (Täg) und mit -er (Stainer, Hemder, Better) und die Bewahrung von -i- im ganzen Singular einiger starker Verben (Kl. III-V: ich wird, nim, lis, gib). Die oberdeutsche Literatursprache bewahrte zudem auch verschiedene Formen, die im Laufe des 16. Jahrhunderts außerhalb des Oberdeutschen obsolet geworden waren, z. B. <-mb> für -m (haimb, umb) oder -e in der 1. und 3. Person Indikativ Präteritum starker Verben (ich/er sahe, ware). Vor allem die Apokope oder Bewahrung des -e gewinnt fast den Charakter eines konfessionell markierten Schibboleths.
Die Syntax stellt sich in vielen Texten hochrhetorisch mit langen, hypotaktisch gegliederten Perioden, mit häufigen Antithesen und Parallelismen und mit Anleihen aus der Kanzleisprache dar. Die Nähe zur lateinischen Stilistik ist nicht zu übersehen. Der Wortschatz ist durch reichlichen Gebrauch von Fremdwörtern gekennzeichnet. In zahllosen Predigten stand die hochkomplexe Sprache einer dem Mündlichen nahen Volkstümlichkeit und Treffsicherheit aber nicht im Wege.
Eine Grammatik des Oberdeutschen

Den Versuch einer Grammatik der oberdeutschen Literatursprache veröffentlichte der Münchner Augustiner-Eremit Gelasius Hieber (1671-1731) 1723-1725 im "Parnassus Boicus" - einer von gelehrten Augustinermönchen und -chorherren herausgegebenen Zeitschrift der katholischen Aufklärung, in der die Aufgaben einer Akademieschrift mit solchen von Sprachgesellschaften verbunden wurden. Der grammatische Abriss war zwar lediglich ein Exzerpt aus der Grammatik von J. Bödiker/J. L. Frisch (Berlin 1723) und somit unoriginell. Aber er ist immerhin ein wichtiges Zeugnis der Reflexion über die eigene Sprache und des Versuchs, gegenüber dem "lutherischen" Hochdeutschen Position zu beziehen. Doch die Zukunft gehörte dem Hochdeutschen, auch in Bayern und Österreich. Diesen modernen Sprachtyp beschrieb der Oberpfälzer Karl Friedrich Aichinger (1717-1782) ("Versuch einer teutschen Sprachlehre", 1753) eigenständig und mit starker Kritik an Johann Christoph Gottscheds (1700-1766) Normanspruch.
Von der oberdeutschen Literatursprache zum Neuhochdeutschen
Den formellen Übergang zum Hochdeutschen hat in Bayern zuerst die Kurbayerische Akademie der Wissenschaften vollzogen. Sie stellte sich zwar ausdrücklich in die Tradition des Parnassus Boicus - ihre Beiträge mussten "in reiner deutscher Sprache verfasst sein" -, aber diese Sprache sollte nun das moderne Hochdeutsche sein. 1765 veröffentlichte Akademiemitglied Heinrich Braun (1732-1792) mit dem Privileg des Kurfürsten Max III. Joseph und mit "Genehmhaltung" der Akademie die "Anleitung zur deutschen Sprachkunst", in wesentlichen Teilen eine Aufbereitung von Gottscheds "Grundlegung zu einer deutschen Sprachkunst" (1748), für bayerische Leser. Indem Braun aber vielfach an den traditionellen Schreibgebrauch anknüpfte, schuf er eine Brücke von der oberdeutschen Literatursprache zum Neuhochdeutschen.
Forschungsgeschichte
Der Begriff "Frühneuhochdeutsch" stammt von Wilhelm Scherer (1841-1886), dessen Periodisierung sich weithin durchgesetzt hat (Althochdeutsch 750-1050, Mittelhochdeutsch 1050-1350, Frühneuhochdeutsch 1350-1650, Neuhochdeutsch ab 1650). Die Forschung verwies für das Oberdeutsche auf die zeitliche Verschiebung sowohl hinsichtlich des Beginns (Spätmittelhochdeutsch bis um 1500; Hugo Moser, 1909-1989) ebenso wie bezüglich des Endes erst um 1750 (Reiffenstein; Wiesinger).
Zunächst kam vor allem der Variantenreichtum des Frühneuhochdeutschen in den Blick, den man nur als Verwahrlosung wahrnahm. Positiv interpretierte man das Frühneuhochdeutsche als Vorbereitungs- und Übergangsphase zum protestantischen Neuhochdeutschen. Erst seit den 1920er Jahren setzte sich die Beurteilung als Sprachperiode eigenen Rechts durch. Verstärkt in Gang kam die Diskussion nach dem Zweiten Weltkrieg, nicht zuletzt angeregt durch Arno Schirokauers (1899-1954) temperamentvollen, polemischen Handbuchartikel (in: Deutsche Philologie im Aufriß, hg. v. Wolfgang Stammler, 1. Auflage 1950). Weitere wichtige Impulse setzten Werner Besch (1967), die Arbeiten aus der Leipziger Schule Theodor Frings' (1886-1968) über die Kanzleisprachen ostmitteldeutscher Städte, jene des Prager Germanisten Emil Skála (1928-2005) über das Egerer Deutsch (1967ff.) sowie Dieter Breuer mit der Arbeit über die oberdeutsche Literatur (1979). Einen neuen Zugang zum überquellenden Wortschatz eröffnet das Frühneuhochdeutsche Wörterbuch von Oskar Reichmann u. a. (1989ff.).
Die wichtigen Arbeiten des Bad Tölzer Privatgelehrten Virgil Moser (1882-1951) zur Grammatik wurden durch die Bonner "Grammatik des Frühneuhochdeutschen" weitergeführt (hg. von Hugo Moser u. a., 1970ff.). Die "Frühneuhochdeutsche Grammatik" von 1993 (Reichmann/Wegera) fasst den heutigen Kenntnisstand zusammen.
Dokumente
Literatur
- Dieter Breuer, Oberdeutsche Literatur 1565-1650. Deutsche Literaturgeschichte und Territorialgeschichte in frühabsolutistischer Zeit (Beihefte der Zeitschrift für bayerische Landesgeschichte B 11), München 1979.
- Frühneuhochdeutsches Wörterbuch, begr. von Robert R. Anderson, Ulrich Goebel, Oskar Reichmann, hg. von Ulrich Goebel und Oskar Reichmann, Berlin 1989ff.
- Frédéric Hartweg/Klaus-Peter Wegera (Hg), Frühneuhochdeutsch: eine Einführung in die deutsche Sprache des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit (Germanistische Arbeitshefte 33), Tübingen 2005.
- Peter von Polenz, Deutsche Sprachgeschichte vom Spätmittelalter bis zur Gegenwart. 1. Band: Einführung. Grundbegriffe. 14.-16. Jahrhundert, Berlin 2. Auflage 2000; 2. Band: 17. und 18. Jahrhundert, Berlin 1994.
- Oskar Reichmann/Klaus-Peter Wegera (Hg.), Frühneuhochdeutsche Grammatik (Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte A 12), Tübingen 1993.
- Ingo Reiffenstein, Aspekte einer Sprachgeschichte des Bayerisch-Österreichischen bis zum Beginn der frühen Neuzeit - Aspekte einer bayerischen Sprachgeschichte seit der beginnenden Neuzeit, in: Werner Besch u. a. (Hg.), Sprachgeschichte. Ein Handbuch zur Geschichte der deutschen Sprache und ihrer Erforschung. 3. Band, Berlin 2. Auflage 2003, 2889-2942, 2942-2971.
- Ingo Reiffenstein, Der "Parnassus Boicus" und das Hochdeutsche, in: Peter Wiesinger (Hg.), Studien zum Frühneuhochdeutschen. Festschrift für Emil Skála, Göppingen 1988, 27-45.
- Ingo Reiffenstein, Heinrich Brauns Anleitung zur deutschen Sprachkunst. "Hochdeutsch", "Oberdeutsch" und "Mundart" im 18. Jahrhundert, in: Zagreber Germanistische Beiträge 2 (1993), 163-178.
- Walter Tauber, Mundart und Schriftsprache in Bayern (1450-1800), Berlin 1993.
Quellen
- Hans Pörnbacher/Benno Hubensteiner (Hg.), Bayerische Bibliothek. Texte aus 12 Jahrhunderten. 1-3. Band, München 1978ff.
Weiterführende Recherche
Externe Links
Verwandte Artikel
Empfohlene Zitierweise
Ingo Reiffenstein, Frühneuhochdeutsch in Altbayern, publiziert am 15.09.2009; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Frühneuhochdeutsch_in_Altbayern (4.02.2026)