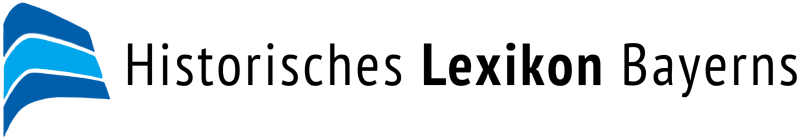Der 1972 beschlossene Erlass der Bundesregierung stand im Zusammenhang mit den vor allem von Konservativen als Bedrohung des demokratischen Systems in Deutschland verstandenen Aktivitäten der sog. Außerparlamentarischen Opposition und deren "Marsch durch die Institutionen". Der Erlass sah vor, dass Bewerber für den Staatsdienst auf ihre Verfassungskonformität hin überprüft werden sollten. Bestanden berechtigte Zweifel an der demokratischen Gesinnung der Bewerber, konnte ihnen aufgrund beamtenrechtlicher Bestimmungen der Eintritt in den Staatsdienst verwehrt werden. Der Erlass führte zu heftigen Auseinandersetzungen und landete 1975 vor dem Bundesverfassungsgericht und 1995 vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Der Ministerpräsidentenbeschluss
Am 28. Januar 1972 beschlossen Bundeskanzler Willy Brandt (SPD, 1913-1992, eigtl. Herbert Ernst Frahm, Bundeskanzler 1969-1974) und die Ministerpräsidenten der Länder bzw. die regierenden Bürgermeister der Stadtstaaten auf einer Konferenz zu "Fragen der inneren Sicherheit" eine Vereinbarung über "Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst".
Ziel dieses "Ministerpräsidentenbeschlusses" war es, Bund und Länder zu einem einheitlichen Vorgehen zu bewegen, um den öffentlichen Dienst von sog. Verfassungsfeinden freizuhalten.
In der Vereinbarung wird darauf hingewiesen, dass die in den Beamtengesetzen in Bund und Ländern festgelegten Verpflichtungen für Beamte "zwingende Vorschriften" seien; demnach müssen Beamte "aktiv innerhalb und außerhalb des Dienstes" für die "freiheitlich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes" eintreten. Jeder Einzelfall müsse "für sich geprüft und entschieden werden". Bewerber für den öffentlichen Dienst, die "verfassungsfeindliche Aktivitäten" entwickelten oder Mitglied von Organisationen mit verfassungsfeindlichen Zielen seien, würden "in der Regel" abgelehnt.
Bereits eingestellte Beamte müssten mit einer "Entfernung […] aus dem Dienst" rechnen, wenn sie durch "Handlungen oder wegen […] Mitgliedschaft in einer Organisation verfassungsfeindlicher Zielsetzung" die Verpflichtung zum Bekenntnis für die freiheitlich demokratische Grundordnung verletzen.
Zum Begriff Radikalenerlass
Dieser Beschluss wurde in den ersten Jahren nahezu ausschließlich "Radikalenerlass" genannt - ein Begriff, der bis heute in Wissenschaft und Öffentlichkeit weitgehend vorherrscht. Weite Verbreitung fand bei den Kritikern des Erlasses, aber auch in der Öffentlichkeit und im Ausland, der Begriff "Berufsverbot" (so v. a. in Frankreich und Skandinavien), während die Befürworter seit Mitte der 1970er Jahre zunehmend von "Extremistenbeschluss" sprachen.
Der Weg zum Radikalenerlass
Bereits vor den 1970er Jahren waren Bestimmungen zum Ausschluss von "Radikalen" aus dem öffentlichen Dienst geschaffen worden. So hatte im Jahr 1950 die Bundesregierung in einem Erlass beschlossen, "Gegner" der "freiheitlich-demokratischen Grundordnung" aus dem Staatsdienst zu entlassen. Von 13 als verfassungsfeindlich eingestuften und aufgelisteten Organisationen wurden 11 dem kommunistischen Spektrum zugeordnet: neben der Kommunistischen Partei Deutschlands (KPD) beispielsweise auch die Freie Deutsche Jugend (FDJ), die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes (VVN), die Sozialdemokratische Aktion oder der Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands.
Daneben wurden noch zwei neonazistische Organisationen, die Sozialistische Reichspartei (SRPD) und die "Schwarze Front" aufgelistet. Dieser sog. Adenauererlass von 1950 war angesichts des antikommunistischen Klimas der 1950er Jahre in der BRD eindeutig gegen Kommunisten gerichtet, während ja gleichzeitig viele ehemalige NS-Belastete wieder eingestellt wurden. Außerdem waren in den Beamtengesetzen Bestimmungen enthalten, die Angehörige des öffentlichen Dienstes zum Eintreten für die "freiheitliche demokratische Grundordnung" verpflichtete.
Einen Höhepunkt erreichte die öffentliche Debatte um die Gefährdung der inneren Sicherheit in den 1950er Jahren durch die breite Kritik an der Wiederbewaffnung der Bundesrepublik 1955/56 und die Auseinandersetzung mit der KPD, die 1956 verboten wurde. Erst Ende der 1960er Jahre kam es dann wieder zu großen Diskussionen um die "innere Sicherheit". Den Hintergrund bildeten die studentische Protestbewegung, neue soziale Bewegungen und die Entstehung zahlreicher oppositioneller und kommunistisch-marxistischer Gruppen und Parteien (vor allem die Gründung der Deutschen Kommunistischen Partei [DKP] 1968 als Nachfolgepartei der KPD) und deren grundlegende Kritik an Gesellschaft, Wirtschaft und Politik der Bundesrepublik. Auch die intensiveren Kontakte zwischen Bundesrepublik und DDR im Zuge der neuen Ostpolitik vor allem seit der Regierungsübernahme durch die SPD/FDP-Koalition 1969 spielten eine Rolle. Als Folge dieser Entwicklung sahen vor allem konservative Politiker die Gefahr einer Unterwanderung des öffentlichen Dienstes durch "linksradikale" Lehrer, Professoren, Juristen und im Sozialbereich Tätige ("Marsch durch die Institutionen") und damit eine Bedrohung der Bundesrepublik. Als Indiz für diese Gefahr wurde auch auf die ersten terroristischen Aktivitäten der 1970 gegründeten Rote Armee Fraktion (RAF) hingewiesen.
In einer Bundestagsdebatte im September 1971 machte der CDU/CSU-Fraktionsvorsitzende Rainer Barzel (CDU, 1924-2006, Fraktionsvorsitzender 1964-1973) seine Befürchtungen deutlich und warf gleichzeitig SPD-Bundeskanzler Willy Brandt vor, nichts gegen diese kommunistische Gefahr zu unternehmen. Um diesem Vorwurf entgegenzutreten, hatte der SPD-geführte Hamburger Senat bereits am 23. November 1971 einen Erlass herausgegeben, der als Vorläufer des späteren Ministerpräsidentenerlasses vom Januar 1972 gilt; gleichzeitig kündigte er der Lehrerin Heike Gohl die Entlassung wegen ihrer "politischen Betätigung für die SDAJ (Sozialistische Deutsche Arbeiterjugend) und DKP" an. Angesichts der nun heftiger geführten Debatte bemühte sich die Bundesregierung um ein einheitliches Vorgehen der Länder; Bundeskanzler Brandt wollte mit dem Erlass die Distanz der SPD zu Kommunisten oder radikalen Kräften der Studentenbewegung deutlich machen, um die heftig umstrittene neue Ostpolitik ("Wandel durch Annäherung") möglichst ohne hitzige Debatten über die Gefährdung der inneren Sicherheit weiterführen zu können.
Handhabung im Bund und in den Ländern
Der Erlass 1972 wurde in den nächsten Monaten bzw. Jahren von den einzelnen Ländern meist mit wenig Änderungen übernommen. Die Umsetzung erfolgte zeitlich und bezüglich der Intensität unterschiedlich: Er wurde zwar in konservativ regierten Ländern meist strenger gehandhabt als in SPD/FDP-regierten Ländern, dennoch wurde er grundsätzlich von den Behörden befolgt und führte zur systematischen Überprüfung aller Bewerber für den öffentlichen Dienst. Im Normalfall wurde von der Einstellungsbehörde bei den Verfassungsschutzämtern nachgefragt ("Regelanfrage"), ob "Erkenntnisse" über den Bewerber vorlägen. Gab es Erkenntnisse, musste der Bewerber in sog. Anhörungsgesprächen Stellung zu den Erkenntnissen nehmen; konnte er die Zweifel nicht ausräumen, erfolgte in der Regel eine Ablehnung. Dagegen konnte geklagt werden, wegen der Berufungsmöglichkeiten erstreckten sich entsprechende Verfahren aber meist über viele Jahre, in denen die Bewerber keine Anstellung erhielten.
Dem Bundesinnenministerium zufolge fanden vom 1. Januar 1973 bis zum 30. Juni 1975 in Bund und Ländern insgesamt 454.000 Sicherheitsüberprüfungen statt; davon wurden 328 Bewerber abgelehnt (Braunthal, Politische Loyalität, 64; Frisch, Extremistenbeschluss, 214).
Insgesamt wurden von 1972 bis 1991 (Jahr der Beendigung des Verfahrens in Bayern als letztem Land) rund 3,5 Mio. Bewerber für den öffentlichen Dienst in Bund und Ländern durch eine "Regelanfrage" der Einstellungsbehörden bei den Verfassungsschutzämtern überprüft (Initiativgruppe 30. Jahrestag: Aufruf "30 Jahre Berufsverbot"; Braunthal, Politische Loyalität, 117); in etwa 11.000 Fällen kam es zu Verfahren, davon wurden 1.250 Personen nicht eingestellt (ebd.; Braunthal, Politische Loyalität, 117). Rund 260 bereits verbeamtete oder angestellte Personen wurden im gleichen Zeitraum entlassen. Zum allergrößten Teil waren Lehrer (rund 80 %) und Hochschullehrer (rund 10 %) betroffen; daneben gab es auch Fälle in der Justiz, bei Bahn und Post. Die meisten Ablehnungen erfolgten von 1973 bis 1979, den Höhepunkt erreichten sie 1975 (Histor, Vergessene Opfer, 79ff.).
Betroffen waren zum größten Teil Mitglieder der DKP oder deren Nebenorganisationen, dann auch Sympathisanten und Mitglieder der sog. K-Gruppen (v. a. Kommunistischer Bund Westdeutschland und KPD) oder auch Unorganisierte, die mit diesen Organisationen politischen Kontakt hatten. Vereinzelt waren auch Angehörige der SPD betroffen, etwa als Mitglieder des Sozialistischen Hochschulbunds (SHB). Zwar sollte der Erlass grundsätzlich auch für das rechtsradikale Spektrum gelten, aber in der Praxis richtete er sich fast ausschließlich gegen "Linksradikale" und blieb damit in der Tradition des "Adenauer-Erlasses" von 1950. Unter den abgelehnten Bewerbern oder entlassenen Beamten fanden sich nur sehr wenige Mitglieder der NPD. So wurden in Bayern zwischen 1973 und 1980 aus dem linken Spektrum 102 Bewerber abgelehnt, dagegen nur zwei aus dem rechten.
Kritik und Befürwortung
Der Erlass wurde von Anfang an heftig kritisiert. An vielen Orten, an denen Bewerber abgelehnt wurden, entstanden Bürgerinitiativen zur Solidarität mit Betroffenen. In der Öffentlichkeit, in Gewerkschaften, Kirchen und Jugendorganisationen, auch in Teilen von SPD und FDP, wurde kritisiert, dass
- der Erlass das Grundrecht nach Art. 3 GG verletze, wonach niemand wegen seiner politischen Anschauungen diskriminiert werden dürfe;
- die Verfassungsfeindlichkeit einer Partei ausschließlich das Bundesverfassungsgericht feststellen könne, nicht jedoch Behörden;
- der Erlass eine stark einschüchternde Wirkung auf junge, kritische Menschen habe, wodurch eine ganze Generation zu "Duckmäusertum" und Anpassung gezwungen werde;
- gerade eine Demokratie nicht mit Verboten auf grundsätzliche Kritik reagieren dürfe;
- der Erlass in der antidemokratischen Tradition der deutschen Geschichte von der Metternich'schen Zensur über das Bismarck'sche Sozialistengesetz bis zur politischen Säuberung während der NS-Diktatur stehe;
- für die Ablehnung eines Bewerbers oft schon die bloße Mitgliedschaft in einer als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation ausreiche, statt das konkrete Verhalten der einzelnen Person zu würdigen;
- es ein Widerspruch sei, eine Partei wie etwa die DKP zwar zuzulassen, die Mitgliedschaft in ihr aber zu sanktionieren;
- in manchen Ländern Lehrer und Juristen auch nicht als Referendare eingestellt würden und damit ihre Berufsausbildung nicht beenden könnten;
- die Nichtanstellung für Lehrer, Post- und Bahnbeamte einem "Berufsverbot" gleichkomme, da es außerhalb des öffentlichen Dienstes praktisch keine Berufstätigkeit gebe;
- der Erlass verstärkt auch in der Privatwirtschaft Anwendung finde;
- die geringe Zahl der endgültigen Ablehnungen zeige, dass die Gefahr einer "kommunistischen Unterwanderung" völlig übertrieben gewesen sei und letztlich nur der Einschüchterung und Stimmungsmache gedient habe.
Kritik kam auch aus dem Ausland, so vor allem aus Frankreich, Großbritannien und Italien, in der vor allem darauf hingewiesen wurde, dass "Berufsverbote" ("le berufsverbot") für Kommunisten in anderen europäischen Ländern undenkbar seien und eine unrühmliche Tradition des Nationalsozialismus fortsetzen würden.
Von den Verteidigern des Erlasses wurde angeführt, dass
- gerade die letztlich geringe Zahl der Ablehnungen die Rechtsstaatlichkeit und Großzügigkeit des Verfahrens zeige und folglich auch keine Einschüchterung für junge Menschen zu befürchten sei;
- gerade die Erfahrung mit dem Nationalsozialismus eine "abwehrbereite" Demokratie verlange, die Gegnern der Demokratie keine Entfaltungsmöglichkeiten im Staatsdienst bieten dürfe;
- angesichts der starken Ausweitung des Bildungsbereichs in den 1970er Jahren das Eindringen von Verfassungsfeinden in Lehrberufe und somit marxistische Indoktrination verhindert werden müsse;
- der Begriff "Berufsverbote" falsch sei, da der Erlass nur den öffentlichen Dienst betreffe;
- den Beamtengesetzen entsprechend auch bisher schon von jedem Beamten das Bekenntnis zur freiheitlich-demokratischen Grundordnung verlangt worden sei und der Erlass nur für eine einheitliche Durchführung in allen Ländern und Bereichen sorge;
- der Erlass auch für den öffentlichen Dienst bei Bahn und Post gültig sein müsse, damit im Falle einer Krise "Extremisten" keine Sabotageakte durchführen könnten.
Um der besonders im europäischen Ausland geäußerten Kritik (so der französische Politologe Alfred Grosser [1925-2024] am 12. Oktober 1975 in seiner Rede in der Frankfurter Paulskirche) am Extremistenbeschluss begegnen zu können, gab die Bundesregierung in den 1970er Jahren rund 70 Mio. DM für entsprechende Öffentlichkeitsarbeit aus. (Drucksache des Deutschen Bundestages 2761, 8. Wahlperiode, 1979)
Umdenken in Bund und Ländern
In einer Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichts vom 22. Mai 1975 anlässlich der Klage eines Jurastudenten, dem das Referendariat und damit das für den Berufsabschluss notwendige 2. Staatsexamen verweigert worden war, stellte das Gericht zwar klar, dass die Behörden den Bewerbern den Abschluss der Ausbildung ermöglichen müssten und eine Einzelfallprüfung zum konkreten Verhalten des Bewerbers notwendig sei. Es bestätigte aber das Recht der Behörden, Bewerber einer als verfassungsfeindlich eingestuften Partei abzulehnen oder zu entlassen, auch wenn die Partei nicht als verfassungswidrig verboten worden sei. Dieses Urteil, das Eingeständnis Willy Brandts Ende der 1970er Jahre, dass der Erlass ein "Irrtum" gewesen sei, die weiter anhaltende Debatte in der Bundesrepublik, vor allem aber die starke Kritik in Medien und Wissenschaft, von Regierungen und Parlamenten aus dem westlichen Ausland (so der spätere französische Präsident François Mitterand [PS, 1916-1996, franz. Staatspräsident 1981-1995]) und Diskussionen in Europarat und Vereinten Nationen führten dazu, dass die SPD/FDP-Bundesregierung unter Helmut Schmidt (SPD, 1918-2015, Bundeskanzler 1974-1982) 1976 und 1979 und einzelne Länderregierungen mit neuen Richtlinien versuchten, die Regelanfrage beim Verfassungsschutz zu beenden. Eine einheitliche Regelung scheiterte im Bundesrat an den CDU/CSU-regierten Ländern, so dass der "Radikalenerlass" je nach politischer Ausrichtung der Länderregierungen unterschiedlich gehandhabt wurde. Auch die Kommunen übernahmen größtenteils die Praxis der Regelanfrage, rückten dann aber - wiederum entsprechend politischer Mehrheiten - seit Ende der 1970er Jahre (Saarbrücken) teilweise davon ab. In München wurde seit 1984 die automatische Anfrage beim Verfassungsschutz eingestellt.
Mit der abnehmenden Zahl der Verfahren seit Ende der 1970er Jahre wurde zwar die öffentliche Debatte etwas geringer, die Kritik im In- und Ausland blieb aber bestehen. So gelangte eine Untersuchungskommission der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO), einer Sonderorganisation der Vereinten Nationen, im Februar 1987 zu dem Ergebnis, dass die Durchführung des Erlasses gegen das Verbot der Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf verstoße. Von besonderer Bedeutung war auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte in Straßburg vom 26. September 1995 zum Fall einer Lehrerin aus Niedersachsen, die 1986 wegen ihrer Mitgliedschaft in der DKP aus dem Schuldienst entlassen worden war. Das Gericht sah darin einen Verstoß gegen das Recht auf Meinungs- und Vereinigungsfreiheit der Europäischen Menschenrechtskonvention. In den folgenden Jahren konnten einige vom Erlass Betroffene ihre Wiedereinstellung in den öffentlichen Dienst erreichen; viele aber hatten sich aufgrund der jahrelangen Auseinandersetzungen um Arbeitsplätze außerhalb des öffentlichen Dienstes bemüht.
Das Ende des Radikalenerlasses im Bund
Schrittweise hoben die SPD-regierten Länder den "Radikalenerlass" auf. In Hamburg gab es ab 1979 keine Regelanfrage mehr. Als erstes Land setzte das Saarland den Erlass 1985 offiziell außer Kraft, als letztes folgte 1991 Bayern. Große Aufmerksamkeit erregte 2004 der Fall eines Realschullehrers aus Heidelberg, dem die Regierung von Baden-Württemberg wegen Mitarbeit in einer antifaschistischen Initiative, die vom Verfassungsschutz als linksextremistisch eingestuft wurde, die Einstellung in den Schuldienst verweigerte. Erst nach einer Entscheidung des Verwaltungsgerichtshofs vom 4. September 2007 wurde der Lehrer in den Schuldienst übernommen.
Handhabung in Bayern
Wie die anderen Länder übernahm auch die Staatsregierung mit Beschluss vom 18. April 1972 den Erlass. In einer Bekanntmachung der Staatsregierung vom 27. März 1973 wurde überdies die Regelanfrage beim Verfassungsschutz über Bewerber zum öffentlichen Dienst in Bayern festgeschrieben. Kurz darauf wurde im Juli 1974 dem Verfassungsschutz die neue Aufgabe übertragen, "bei der Überprüfung von Personen, die sich um Einstellung in den öffentlichen Dienst bewerben", mitzuwirken. Damit gehörte Bayern zu den Ländern, die den Erlass streng auslegten und jeden Bewerber vom Verfassungsschutz überprüfen ließen. Konnten vom Verfassungsschutz als "extremistisch" eingestufte Bewerber die Zweifel nicht glaubhaft entkräften, so reichte in den meisten Fällen die Mitgliedschaft in einer vom Verfassungsschutz als verfassungsfeindlich eingestuften Organisation als Grund für die Ablehnung.
Während 1972 nur wenige Personen betroffen waren, stiegen die Zahlen in Bayern in den kommenden Jahren stark an. Den Höhepunkt bildete das Jahr 1975 mit über 26.000 Anfragen bei 33 Ablehnungen von Bewerbern durch die Einstellungsbehörden; vom 1. April 1973 bis Ende 1982 wurden rund 227.000 Anfragen beim Landesamt für Verfassungsschutz gestellt; insgesamt wurde 127 Personen die Einstellung verwehrt (Verfassungsschutzbericht Bayern für das Jahr 1982, 155). Betroffen waren fast ausschließlich sog. Linksradikale. So wurden in Bayern zwischen 1973 und 1980 aus dem linken Spektrum 102 Bewerber abgelehnt, dagegen nur zwei aus dem rechten. In den Folgejahren wurden bis 1990 jährlich jeweils rund 20.000 Bewerber überprüft und jeweils zwischen ein bis sechs Bewerber abgelehnt.
Die Staatsregierung stellte sich in Regierungserklärungen und Parlamentsdebatten offensiv hinter den Ministerpräsidentenbeschluss von 1972 und trat vehement allen Versuchen der Abmilderung entgegen; aufgrund des Beschlusses des Bundesverfassungsgerichts von 1975 konnten Rechtsreferendare ihre Ausbildung aber auch in Bayern statt im Beamtenstatus in einem öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnis abschließen.
Umdenken in Bayern
Die Opposition im Landtag forderte immer wieder die Beendigung der Regelanfrage bei allen Bewerbern, da sie als "Gesinnungsschnüffelei" nur zur Einschüchterung und zu politischer Untätigkeit junger Menschen führen würde. An vielen Orten wie München, Nürnberg, Augsburg und Regensburg entstanden "Bürgerinitiativen gegen Berufsverbote", welche vor allem die Unterstützung der Betroffenen bei den oft jahrelangen Prozessen organisierten. Eine Reihe von spektakulären Ablehnungen wie die einer sozialdemokratischen Juristin oder eines nicht-parteigebundenen und in der Friedensbewegung aktiven Religionslehrers in Nürnberg führten auch in der Öffentlichkeit zu großen Debatten. Die Einleitung eines Disziplinarverfahrens der Regierung von Mittelfranken 1974 gegen einen seit vielen Jahren verbeamteten Lehrer und Mitglieds der DKP war einer der ersten Versuche, einen Lebenszeitbeamten aus dem Dienst zu entfernen. Aufgrund des breiten Protestes auch von Eltern und Schülern wurde die Entlassung nicht weiterverfolgt; ein nach der Pensionierung 1982 eingeleitetes Vorermittlungsverfahren wegen neuerlicher Kandidatur für die DKP wurde ein Jahr darauf eingestellt.
Als letztes Land beendete Bayern 1991 das bisherige Verfahren und damit die "Regelanfrage", führte aber als bisher einziges Land ein neues Verfahren ein, nämlich die Bekanntmachung der Staatsregierung vom 11. Dezember 1991 "Pflicht zur Verfassungstreue im öffentlichen Dienst". Hintergrund ist der Beitritt der neuen Länder zur Bundesrepublik, deren Bewerber nun ebenfalls in die Überprüfung einbezogen werden. Das neue Verfahren verpflichtet jeden Bewerber für den öffentlichen Dienst in Bayern, auf einem Fragebogen anzugeben, ob er Mitglied oder Unterstützer einer der als verfassungsfeindlich aufgelisteten Organisationen war oder ist; unter den aktuell über 200 genannten in- und ausländischen Gruppen und Parteien befindet sich auch die Partei "Die Linke" einschließlich ihrer Vorläufer. Aufgrund dieser Angaben erfolgen dann gegebenenfalls Anfragen bei der Verfassungsschutzbehörde, die zu einer Ablehnung des Bewerbers führen können. Kritiker sprechen von einer Neuauflage des "Radikalenerlasses".
Literatur
- Gerard Braunthal, Politische Loyalität und Öffentlicher Dienst: der Radikalenerlass von 1972 und die Folgen, Marburg 1992.
- Peter Frisch, Extremistenbeschluss. Zur Frage d. Beschäftigung von Extremisten im öffentlichen Dienst mit grundsätzlichen Erlassen, Argumentationskatalog, Darstellung extremistischer Gruppen und einer Sammlung einschlägiger Vorschriften, Urteile und Stellungnahmen, Heggen 4., überarb. u. aktualisierte Aufl. 1977.
- Manfred Histor, Willy Brandts vergessene Opfer. Geschichte und Statistik der politisch-motivierten Berufsverbote in Westdeutschland 1971-1988, Freiburg 1992.
- Joachim Perels, Keine Erfolgsgeschichte des demokratischen Rechtsstaats: Zur strafrechtlichen Ausschaltung von Kommunisten in der Ära Adenauer, in: Einsprüche. Politik und Sozialstaat im 20. Jahrhundert. Festschrift für Gerhard Kraiker/Antonia Grunenberg (Hg.), Hamburg 2005, 193-203.
- Jörg Requate, Der Kampf um die Demokratisierung der Justiz. Richter, Politik und Öffentlichkeit in der Bundesrepublik (Campus Historische Studien 47), Frankfurt am Main 2008.
- Klaus-Henning Rosen, Anmerkung zur Treuepflicht des öffentlichen Dienstes der Bundesrepublik Deutschland. Die Geschichte des Extremistenbeschlusses, in: Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte 19 (1990), 411-427.
- Peter Voegeli, Völkerrecht und 'Berufsverbote' in der Bundesrepublik Deutschland 1976-1992. Die Kontrollverfahren der Internationalen Arbeitsorganisation in Theorie und Praxis (Beiträge zur politischen Wissenschaft 83), Berlin 1995.
Quellen
- Drucksache des Deutschen Bundestages 2761, 8. Wahlperiode, 1979.
- "DFG/VK im kommunistischem Fahrwasser", in: Sulzbach-Rosenberger Zeitung, 27.12.1976.
- "Grabstein zum Protest", in: Abendzeitung, 22.1.1977.
- "Das Kabinett sieht fern und rot", in: Augsburger Allgemeine, 16.2.1977.
- "'Panorama' gibt einseitige Darstellung zu", in: Die Welt, 21.2.1977.
- "Was einem Bewerber zugemutet werden kann", in: Augsburger Allgemeine, 17.3.1977.
Weiterführende Recherche
Externe Links
Verwandte Artikel
Extremistenbeschluss, Radikalen-Erlass, Ministerpräsidentenbeschluss, Grundsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst, Beschluss der Ministerpräsidenten zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte im öffentlichen Dienst
Empfohlene Zitierweise
Friedbert Mühldorfer, Radikalenerlass, publiziert am 16.06.2014; in: Historisches Lexikon Bayerns, URL: <https://www.historisches-lexikon-bayerns.de/Lexikon/Radikalenerlass> (4.02.2026)